![]()
![]()
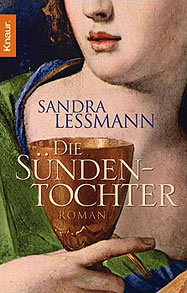
Leseprobe
Erstes
Kapitel
Dezember
1665
Alle Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen. Nun, da es vorbei war, verließen sie schlagartig die Kräfte. Ihre Knie gaben nach, und sie glitt an der Wand des Schuppens zu Boden. Die eisige Kälte, die in die nackte Haut ihrer Schenkel biss, erreichte ebenso wenig ihr Bewusstsein wie der Schmerz, der ihren Körper durchbohrte. Wie gelähmt saß sie da, ohne sich zu rühren, ohne etwas zu fühlen ...
Ein fernes Geräusch ließ sie zusammenfahren. Er kommt zurück! Ihr Herz begann wild zu schlagen. Mit fahrigen Händen raffte sie ihr Hemd über der Brust zusammen, um ihre Blöße zu bedecken, und zog hastig ihr Mieder zurecht. Sie wollte aufspringen und weglaufen, doch ihre Beine bewegten sich nicht. Wie ein in die Enge getriebenes Tier presste sie sich in eine Ecke des Schuppens, den Blick wie gebannt auf die Tür gerichtet. Doch nichts geschah. Er kam nicht zurück. Er hatte bekommen, was er wollte. Aber morgen oder übermorgen würde er ihr wieder auflauern ... und er würde es wieder und wieder tun!
Allmählich begann sie die Kälte zu spüren, die aus der Erde in ihre Haut drang. Sie versuchte, die verrutschten Wollstrümpfe über ihre Knie zu ziehen und die Strumpfbänder zu befestigen, doch ihre klammen Finger waren wie Fremdkörper an ihren Händen und wollten ihr nicht gehorchen.
"Anne! Anne!" Es war die Stimme ihrer Mutter. "Anne, wo bist du?"
Die Tür des Schuppens öffnete sich knarrend. "Anne, warum antwortest du nicht?", fragte ihre Mutter und trat mit besorgter Miene zu ihr. Das Gesicht ihrer Tochter sagte mehr als alle Worte. "Was ist passiert? Hat er dich wieder angefasst? Hat er ...?"
Da brach sich der Schrecken des Mädchens endlich in einem tiefen Schluchzen und einer Flut von Tränen Bahn. Ihre Mutter nahm sie in die Arme, presste sie an sich und versuchte, sie zu beruhigen. Immer wieder strich ihre Hand zärtlich über den Kopf ihrer Tochter.
"Ich
werde ihn zur Rede stellen!", versprach sie. "Ich werde dafür
sorgen, dass er dich in Ruhe lässt. Er wird es nie wieder wagen,
dich anzurühren!"
Der Schleier des Todes, der so lange über der Stadt London gelegen hatte, begann sich endlich zu lüften. Den ganzen Sommer über hatte die Pest verheerend gewütet, hatte Tausende und Abertausende unerbittlich hinweggerafft, bis sie nun mit Eintritt des Winters allmählich ihren Würgegriff lockerte. Innerhalb weniger Wochen erwachte die Geisterstadt zu neuem Leben. Viele der Bürger, die bei Ausbruch der Seuche in Panik aufs Land geflohen waren, kehrten zurück, begierig, ihre Geschäfte wieder aufzunehmen und nach ihrem Besitz zu sehen, den sie zurückgelassen hatten. Die Läden der Handwerker und Kaufleute öffneten ihre Türen, die ausgestorbenen Straßen, auf denen das Gras zwischen den Pflastersteinen gesprossen war, belebten sich neu. Die Menschen wichen einander nicht mehr aus Angst vor Ansteckung aus, sondern grüßten sich, wenn sie sich begegneten, blieben stehen und plauderten fröhlich miteinander.
Der starke Schneefall, der im Februar einsetzte, bedeckte schließlich auch die Gräber der Toten auf den Kirchhöfen und entzog sie so den Blicken der Lebenden, die die schreckliche Heimsuchung vergessen und ihr Leben neu ordnen wollten. Man wagte wieder, in die Zukunft zu sehen und auf die Gnade Gottes zu hoffen.
Zwei Gestalten in wollenen Umhängen eilten durch die weißen Schleier herabfallender Schneeflocken. Ein kleiner Junge, der eine Fackel trug, ging ihnen voraus, um ihnen zu leuchten, denn es war bereits später Abend. Wohl dem, der bei diesem ungemütlichen Wetter in seinen schützenden vier Wänden vor der wärmenden Feuerstelle saß und keinen Fuß vor die Tür zu setzen brauchte. Doch Margaret Laxton konnte sich als Hebamme einen derartigen Luxus nicht leisten. Wenn man sie rief, musste sie zur Stelle sein, egal zu welcher Tageszeit, ob bei Regen oder Schnee. Kinder richteten sich nun einmal nach keiner Uhr, sie bestimmten selbst den Zeitpunkt, zu dem sie zur Welt kommen wollten. Margaret Laxton verlangsamte ihre Schritte und blickte sich besorgt nach ihrer Tochter Anne um, die immer wieder zurückfiel. Anne war zugleich ihr Lehrmädchen und erlernte bei ihr das Handwerk der Hebamme.
"Komm, mein Kind", rief Margaret Laxton ihr zu. "Wir dürfen den Burschen nicht aus den Augen verlieren. Dieser Lümmel hat offenbar die Absicht, uns durch halb Smithfield zu hetzen."
Unter der Kapuze des Wollumhangs richteten sich Annes gerötete Augen mit einem gequälten Ausdruck auf sie.
"Es wird alles gut", sagte ihre Mutter tröstend. "Vertrau mir. Eins meiner Rezepte bringt alles wieder ins Lot. Nur ein bisschen Geduld, dann ist es vorbei. Und Vater wird nichts merken."
Sie nahm die Hand ihrer Tochter und setzte sich wieder in Bewegung. Am Pie Corner wartete der Fackelträger und mahnte sie ungeduldig zur Eile.
"Wie weit ist es denn noch, Junge?", fragte Margaret Laxton.
"Nur noch rechts in die Cock Lane, dann sind wir da", erklärte er und lief ihnen wieder voraus. Die Schneeflocken fielen so dicht, dass sie seine kleine schlanke Gestalt augenblicklich verschluckten. Nur das Licht seiner Pechfackel, das wie ein Leuchtkäfer in der Luft tanzte, war noch sichtbar. Die Hebamme versuchte zu ihm aufzuschließen und zog ihre Tochter energisch hinter sich her. Doch der Junge bewegte sich bedeutend leichtfüßiger über den gefrorenen Boden als die beiden Frauen, deren Rocksäume den Schnee aufwirbelten. Durch die schwere Tasche mit den Utensilien ihrer Zunft, die Margaret Laxton über der Schulter trug, wurde es für sie noch beschwerlicher, mit dem Knaben mitzuhalten, der flink wie ein Wiesel in die Cock Lane einbog. Der Leuchtkäfer verschwand aus dem Blickfeld der Frauen. Wieder trieb die Hebamme ihre Tochter zur Eile an.
Als sie die Ecke erreichten, verlangsamte Margaret Laxton verdutzt ihre Schritte und versuchte, das Schneegestöber mit den Augen zu durchdringen. Wo war der Bengel geblieben?
"He, Bursche, wo bist du?", rief sie, und als keine Antwort kam, begann sie, Anne an der Hand, zu laufen, um ihren Führer einzuholen. In ihrer Hast übersah sie einen Misthaufen, den einer der Hühner haltenden Anwohner in der schmalen Gasse aufgeschüttet hatte. Sie geriet ins Stolpern und wäre beinahe gefallen. Es gelang ihr gerade noch, sich zu fangen. Keuchend blieb sie stehen und sah sich erneut verwirrt um. Dabei fiel ihr Blick auf das Ende eines Stocks, der aus dem Unrathaufen herausragte. Sie zog ihn heraus und berührte mit der Hand vorsichtig das andere Ende. Es war warm und klebrig und roch stark nach verbranntem Pech.
"Was hat das zu bedeuten?", murmelte sie verständnislos. Warum hatte der Junge seine Fackel gelöscht? Und wohin war er verschwunden?
"Mum, was ist denn?", fragte Anne beunruhigt.
"Ich weiß es nicht, mein Liebes. Ich weiß es nicht ..."
Irgendwo schnaubte ein Pferd. Margaret Laxton wandte den Kopf und spitzte die Ohren, um festzustellen, aus welcher Richtung der Laut kam.
"Ich glaube, da ist jemand hinter uns", sagte sie leise und zog ihre Tochter mit sich fort. "Gehen wir weiter. Das Ganze ist mir nicht geheuer."
Anne folgte ihr stumm, während die Hebamme sich immer wieder umdrehte und zurückblickte. Und mit einem Mal sah sie etwas: Eine dunkle Gestalt trat aus der Finsternis der Häuserreihe in die Gasse hinein, ein Mann in einem Umhang mit einem tief ins Gesicht gezogenen Hut. Sein Anblick war so unheimlich, dass Margaret Laxton innehielt und wie gebannt zu ihm hinüberstarrte.
"Der Teufel ...", hauchte sie.
Die Gestalt bewegte sich, ein Arm verschwand unter dem Umhang und wurde kurz darauf wieder sichtbar, streckte sich ihnen entgegen ... ein Funke blitzte auf, ein lauter Knall ertönte ... Margaret Laxton brach zusammen, zu überrascht, um einen Laut von sich zu geben. Sie war tot, bevor ihr Körper auf dem Boden aufschlug ...
Als sie fiel, löste sich ihre Hand aus der ihrer Tochter. Anne starrte ungläubig auf ihre Mutter hinab, die sich nicht mehr rührte. Sie wirbelte entsetzt herum, ihr Blick richtete sich auf die erschreckende Gestalt, registrierte noch einmal dieselbe Bewegung des Arms, der unter dem Umgang verschwand und nach etwas tastete ... nach einer zweiten Waffe, wie sie instinktiv begriff ...
Schreiend
warf sich Anne herum und begann zu laufen, rannte, was ihre Beine hergaben,
blind und ziellos. Immer wieder glitt sie auf der gefrorenen Erde aus,
raffte sich verzweifelt auf und rannte weiter. Sie konnte nicht aufhören
zu schreien, erst als ihr vor Erschöpfung und Angst die Luft wegblieb,
versagte ihr die Stimme.
Sir Orlando Trelawney bewegte sich auf Freiersfüßen. Anderthalb Jahre war es nun her, dass des Richters erste Frau Elizabeth bei einer Fehlgeburt gestorben war. Fünfzehn Jahre lang hatte sie Freud und Leid mit ihm geteilt und mit derselben Inbrunst wie er darum gebetet, dass wenigstens eines ihrer schwächlichen Kinder das Säuglingsalter überleben möge. Aber Gott hatte anders entschieden. Eines nach dem anderen hatte er die winzigen, zerbrechlichen Wesen zu sich geholt, die Elizabeth alle zwei Jahre zur Welt brachte. Die ständigen Schwangerschaften und die anstrengenden Geburten hatten die zierliche Frau allmählich ausgezehrt. Doch sie hatte sich niemals beklagt. Das letzte Kind, das in ihr herangewachsen war, hatte sie schließlich das Leben gekostet. Und Sir Orlando verlor nicht nur eine liebende und geduldige Gefährtin, mit ihr starb auch die Hoffnung auf ein Kind von seinem Fleisch und Blut, die Erfüllung seines sehnlichsten Wunsches.
Die Zeit der Witwerschaft war Trelawney unerträglich geworden. Allein in seinem großen Haus in der Chancery Lane, nur von Dienstboten umgeben, empfand er die Einsamkeit wie eine göttliche Strafe. Der Wunsch, ihr zu entkommen, hatte ihn das Erlöschen der Pest und die Rückkehr der bürgerlichen Familien in die Stadt mit steigender Ungeduld erwarten lassen. Es dauerte nicht lange, bis sich herumsprach, dass einer der Richter des Königlichen Gerichtshofs auf Brautschau war. Und da er überdies für einen Mann in seiner Position relativ jung war - er hatte vor wenigen Monaten sein dreiundvierzigstes Jahr vollendet -, durfte er hoffen, eine Gemahlin zu finden, die ihren ehelichen Pflichten nicht mit Widerwillen nachkommen würde. Bald konnte sich Sir Orlando vor Einladungen zum Mittagsmahl bei den besten Familien Londons kaum mehr retten. Einige nahm er an, andere lehnte er taktvoll ab. Schließlich ließ er einem reichen Landbesitzer namens George Draper gegenüber ein vorsichtiges Interesse an dessen Tochter Sarah durchblicken. Der Vater war ein flammender Royalist und hatte wie Trelawney im Bürgerkrieg auf der Seite des Königs gegen die Parlamentarier unter Oliver Cromwell gekämpft. Nach der Hinrichtung des Königs Charles I. hatte Draper während des Commonwealth einige seiner Ländereien durch Requirierung an Cromwells Anhänger verloren und sie auch nach der Thronbesteigung des neuen Königs Charles II. vor fünf Jahren nicht zurückerhalten. Doch er war noch immer reich genug, um seine einzige Tochter mit einer ansehnlichen Mitgift auszustatten.
Auch wenn noch keine konkreten Verhandlungen aufgenommen worden waren, bestand inzwischen ein unausgesprochenes Einverständnis beider Parteien. Sir Orlando erhielt eine Einladung, zu Lichtmess das Wochenende auf dem Landsitz der Drapers in Essex nicht weit von London zu verbringen. Man vertrieb sich die düsteren Wintertage mit Schach, Billard und Cribbage, einem beliebten Kartenspiel. Abends wurde musiziert. Sarah Draper spielte Spinett und sang dazu, begleitet von ihrer jüngeren Base Jane Ryder, die eine herrliche Singstimme besaß. Trelawney genoss den Aufenthalt sehr, fühlte sich aber bedrängt durch die wachsende Ungeduld des Familienvaters, der zweifellos damit gerechnet hatte, dass sein Gast das Wochenende nutzen würde, um die Eheverhandlungen zu eröffnen. Doch Sir Orlando zögerte. Er wollte sicher sein, dass Sarah Draper die richtige Frau für ihn war, und noch war er davon nicht völlig überzeugt.
Während er nun an diesem Montagabend in seiner Kutsche vom Landsitz der Drapers nach London zurückfuhr, beschäftigten sich seine Gedanken unablässig mit seiner zukünftigen Braut. Die Unsicherheit, die ihn vor dem letzten Schritt zurückschrecken ließ, wollte nicht vergehen. Er verspürte das starke Bedürfnis, mit einem anderen über seine Zweifel zu reden und sich Rat zu holen, am besten bei jemandem, der sich mit Menschen auskannte, hinter ihre Fassade blickte und sie nüchtern und unvoreingenommen einschätzen konnte. Für diese Aufgabe kam nur sein Freund Dr. Fauconer in Frage. Ja, er würde ihn sobald wie möglich aufsuchen und mit ihm über die Angelegenheit sprechen.
Sir Orlandos Gedankengang wurde jäh unterbrochen, als sein Kutscher ohne Vorwarnung in die Zügel griff und die Pferde zum Stehen brachte. Der Richter wurde auf seiner Sitzbank durchgerüttelt und holte schon Luft, um dem Bediensteten gehörig den Kopf zu waschen, als die gellenden Schreie einer Frau an sein Ohr drangen. Sofort begriff er, weshalb der Kutscher angehalten hatte. Jemand war in Not.
Trelawney öffnete den Schlag und stieg aus. Dicke weiche Schneeflocken wehten unter seine Hutkrempe in sein Gesicht und blieben in seinen Wimpern hängen. Sein Kammerdiener Malory war von dem hinteren Fußbrett gesprungen, auf dem er mit einem Lakaien während der Fahrt gestanden hatte, und trat neben den Richter. Ein zweiter Lakai, der der Kutsche mit einer Fackel vorangegangen war, eilte herbei, um ihnen zu leuchten.
"Wer hat geschrien?", fragte Sir Orlando. "Hast du etwas gesehen, Malory?"
Der Kammerdiener ließ suchend den Blick schweifen. Dann hob er plötzlich den Arm und deutete in eine Seitenstraße.
"Dort, Sir!"
Trelawney folgte seinem ausgestreckten Finger und blinzelte, um seine Wimpern vom Schnee zu befreien. Da sah er sie auch: eine junge Frau, die durch den weißen Vorhang stürzte und schreiend in ihre Richtung stolperte, als werde sie von Dämonen verfolgt.
Ohne zu zögern lief Malory ihr entgegen. In diesem Moment tauchte hinter ihr eine zweite Gestalt auf, ein Mann in einem schwarzen Umhang, dessen Gesicht ein breitkrempiger Hut verbarg.
Trelawneys Hand schnellte an seine Seite und schloss sich um den Griff seines Degens. "Malory!", schrie er warnend. "Komm zurück!"
Doch der Diener gehorchte nicht, sondern beschleunigte seine Schritte, so weit ihm dies auf dem hart gefrorenen Untergrund möglich war. Als er sie fast erreicht hatte, stolperte die junge Frau und fiel auf die Knie. Ihr Verfolger hob seine Pistole und legte auf sie an.
"Nein! Nein!", schrie Malory, ohne anzuhalten.
Der Fremde zögerte, die Mündung seiner Waffe zielte noch immer auf das Mädchen, doch als er sah, dass der Diener direkt auf ihn zukam, richtete er die Pistole auf ihn und drückte kaltblütig ab. Der Schuss dröhnte in Malorys Ohren. Im nächsten Moment spürte er, wie ihm die Beine weggerissen wurden. Mit einem Aufschrei ging er zu Boden. Der Fremde wandte sich um und verschwand wie ein Geist in der Nacht.
Den Lakaien mit der Fackel an seiner Seite, näherte sich Sir Orlando mit gezücktem Degen seinem Diener, der sich, vor Schmerzen schreiend, am Boden wand. Als Trelawney sah, dass der Schütze fort war, steckte er den Degen weg und beugte sich über Malory, während sein Lakai das schluchzende Mädchen zu beruhigen versuchte.
Malorys Hände hatten sich um seinen linken Schenkel gekrampft, oberhalb des Knies, von dem das Blut über seine weißen Strümpfe rann und den frischen Schnee unter ihm rot färbte. Es war unmöglich, zu sagen, wie schwer er verletzt war, doch wie es schien, hatte die Kugel ihm das Knie zerschmettert. Malorys Schmerzensschreie gingen in ein gequältes Wimmern über. Sein Magen drehte sich um, er wandte den Kopf zur Seite und erbrach sich.
Trelawneys Hand drückte besänftigend seine Schulter. "Schon gut, mein Junge. Ich bringe dich so schnell wie möglich zu einem Wundarzt."
Da Sir Orlando nichts anderes zur Hand hatte, nahm er seinen Spitzenkragen ab und wickelte ihn um das verletzte Knie seines Dieners, um die Blutung zu stillen. Malory stöhnte vor Schmerzen und biss knirschend die Zähne zusammen.
"Mädchen, was wollte dieser Kerl von dir?", fragte der Richter schließlich die junge Frau, die ihn verschreckt ansah.
"Er hat meine Mutter getötet", presste sie mühsam hervor, und diese wenigen Worte schienen bereits eine ungeheuerliche Kraftanstrengung für sie zu bedeuten.
"Wo ist das passiert?"
Anne Laxton hob nur stumm die Hand und zeigte in die Richtung, aus der sie gekommen war.
"Jack, gib mir die Fackel und bleib bei Malory und dem Mädchen", befahl Trelawney, zog seinen Degen und ging mit angespannten Sinnen die schmale dunkle Gasse entlang. Nach etwa fünfzig Yards entdeckte er vor sich einen kleinen Hügel von der Größe eines menschlichen Körpers. Der dichte Pulverschnee hatte die Frau bereits mit einem weißen Leichentuch zugedeckt. Als Sir Orlando sich über sie beugte und nach einem Herzschlag tastete, versanken seine Finger in einem warmen klebrigen Loch. Die Kugel musste direkt ins Herz gedrungen sein. Hier war nichts mehr zu machen.
Eilig kehrte der Richter zu seinen Dienern und dem Mädchen zurück. "Bring sie zur Kutsche", befahl er Jack. Dem zweiten Lakaien, Tom, gab er die Anweisung, ihm mit Malory zu helfen. Gemeinsam knieten sie sich neben den Verletzten. Malory war seit vielen Jahren in Trelawneys Diensten und ihm stets treu ergeben gewesen. Es war tragisch, dass er durch eine freilich tollkühne und selbstlose, aber leichtsinnige Tat zum Krüppel wurde. Der junge Mann schien sich seines traurigen Schicksals bewusst zu sein, denn seine tränenerfüllten Augen richteten sich mit einem verzweifelten Ausdruck auf Sir Orlando.
"Mein Bein ...", stammelte er. "Ich will mein Bein nicht verlieren ... bitte, lasst nicht zu, dass sie mir das Bein abschneiden ..."
Trelawney verspürte aufrichtiges Mitleid für ihn, wusste aber nicht, wie er ihn trösten sollte. "Egal, was passiert, du wirst immer einen Platz in meinem Haus haben", erklärte er unbeholfen. Er meinte, was er sagte. Malory hatte sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er hatte seinen Herrn hingebungsvoll gepflegt, als dieser krank gewesen war, und er hatte mit einer Waffe neben seinem Bett geschlafen, um ihn zu beschützen, als Trelawney bedroht wurde. Ein treuer Diener war eine Seltenheit und verdiente Pflege und Obdach, auch wenn er nicht mehr in der Lage war, seine Arbeit zu tun.
Behutsam hoben Sir Orlando und Tom den Verwundeten hoch und trugen ihn zur Kutsche. Als sie seine Beine beugen mussten, um ihn durch die schmale Tür ins Innere zu befördern, hörten sie ein knöchernes Knacken. Malory schrie gequält auf. Und als er endlich auf der hinteren Bank saß, war sein Gesicht kalkweiß und seine Hände zitterten wie Espenlaub.
Sir Orlando wandte sich an seinen Kutscher: "Wo sind wir hier?"
"Am Holborn-Brunnen, Mylord."
"Gut,
fahr zum Newgate und von dort weiter in die Paternoster Row zur Chirurgenstube
von Meister Ridgeway."